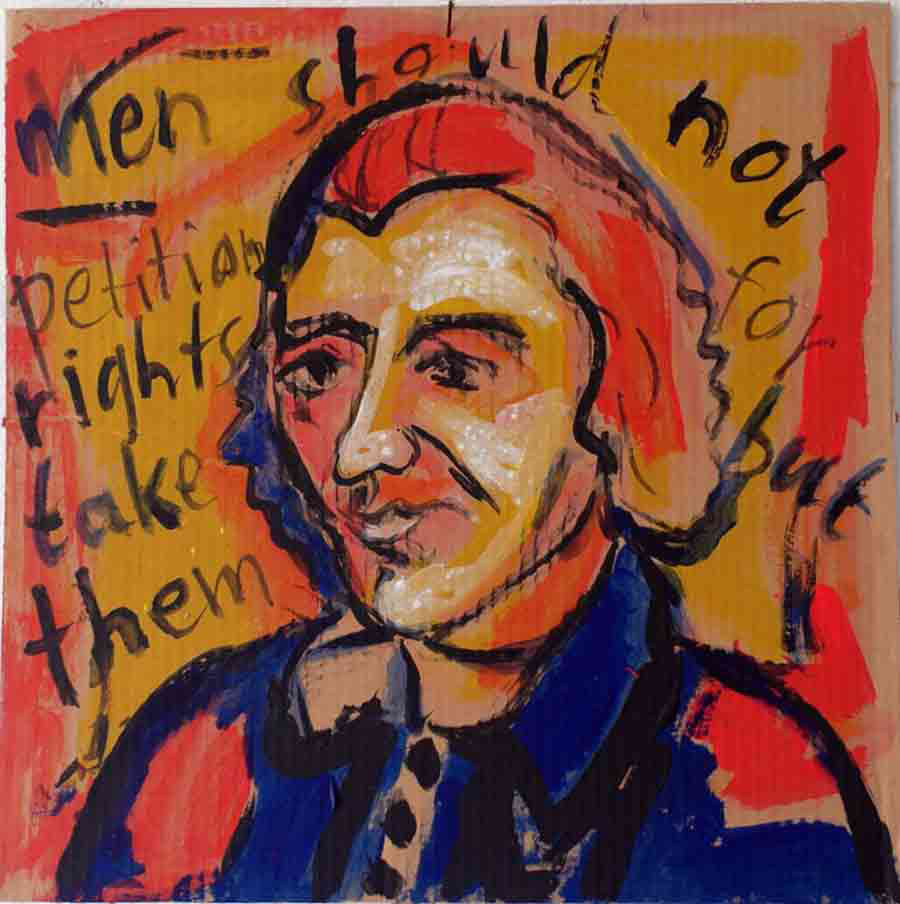
Den Anforderungen nicht mehr gewachsen
Die Krise in den USA ist vor allem eine Verfassungskrise
Der Frankfurter Sozialphilosoph Rainer Forst hat in einem kürzlich publizierten Essay „Die Demokratie in der Krise“ in der FR (02.01.2021) dafür geworben, zwischen „Strukturkrisen“ und „Rechtfertigungskrisen“ zu unterscheiden. Seine These ist, dass es sich bei der gegenwärtigen Krise in Deutschland und Europa nicht um eine Strukturkrise, sondern dass es sich um eine Krise der Rechtfertigung handelt. In Bezug auf die USA muss man diese These umdrehen. Was wir vor uns haben, ist nicht nur eine Krise der Legitimation von Politik, sondern eine Strukturkrise des politischen Prozesses in den USA als eines Ganzen.
Wenn wir von der Struktur eines politischen Gemeinwesens sprechen, meinen wir die Verfassung eines Staates oder einer politischen Gemeinschaft. Wenn wir davon ausgehen, dass in einer Verfassung die grundlegenden Abläufe definiert werden, die nicht nur die staatlichen Institutionen im engeren Sinne (Regierung, Parlament, Wahlen, Parteien) regeln, sondern sich auch auf die staatlichen Apparate (Rechtsinstitutionen, Militär, Polizei, Gefängnisse) und sogar Ausbildungssystem, Mediensystem und Sozialstaat beziehen können (wie in Deutschland), so ergibt sich, dass im Falle der Nichtfunktion aller oder entscheidender Apparate und Regeln von einer Verfassungskrise zu sprechen ist. Eine Verfassungskrise besteht dann, wenn eine politische Gemeinschaft nicht etwa durch politischen Aufruhr instabil wird, sondern sie aufgrund ihrer eigenen Funktionsschwäche politische Gegenwehr hervorruft – und eine solche Situation haben wir jetzt in den USA vor uns.
Diese Sachlage wird verzerrt durch die Fernsehbilder einer aufgebrachten Menge, die die Fenster des Kapitols einschlägt. Dieser Clash ist aber ein Effekt der US-Verfassung, die strukturell nicht mehr den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gewachsen ist. Politische Feindschaft und Gewalt stehen oft nicht nur am Anfang vieler moderner Verfassungen, sondern können auch als Zeichen eines Zerfalls verstanden werden. Und dies ist das Krisenmoment in der gegenwärtigen Situation der USA.
In den USA zerfällt die politische Ordnung
Verfassungen beinhalten die politische Grundordnung eines Staates. Verfassungsgesetze sind in der Neuzeit fast immer das Ergebnis politischer, oft auch gewalttätiger Auseinandersetzungen. Sie machen also einen übergeordneten Rahmen möglich, der von allen politischen Akteuren als gegeben vorausgesetzt werden muss, wenn politischer Streit nicht in politischer Feindschaft enden soll. Wenn Letztere die Oberhand gewinnt, wird die Ordnung instabil. Das Prinzip jeder staatlichen Verfassung ist im Grunde sehr einfach, nämlich der Versuch, politische Macht- und Entscheidungsprozesse dem Recht zu unterwerfen, um so nicht nur Macht und Machtgebrauch einem rationalen Entscheidungsverfahren zuzuführen, sondern auch die Souveränität eines politischen Gemeinwesens nach außen und innen festzulegen und abzugrenzen. So enthalten Verfassungen verbindliche Regelungen über die Staatsorganisation und Legitimation staatlicher Organe und deren genaue Verfahrensweisen. Die Idee einer liberalen und repräsentativen Demokratie sitzt auf der Idee eines verfassten Staates im Sinne einer Ordnung von Interessen und Gruppen auf. Verfassung ist gleichzusetzen mit Ordnung.
Was wir seit Jahren in den USA beobachten, ist nicht nur der Verfall des Landes in sozialer Hinsicht, sondern ein langsamer Zerfall der politischen Ordnung. Trump ist nicht die Ursache dieser Krise, sondern nur deren sichtbares Zeichen. Es handelt sich um den Versuch, den Bezug von Recht und Politik in ein anderes Verhältnis zu setzen, das heißt, in eine andere Ordnung zu überführen.
Zwei entscheidende Unterschiede zu anderen Verfassungen prägen die Verfassung der USA
Die US-Verfassung weist neben vielen kleineren Aspekten zwei Züge auf, die sich von anderen westlichen Verfassungen unterscheiden: Erstens ist die gesamte Verfassung nicht nur föderalistisch orientiert, sondern substanziell darauf aufgebaut. Abgeordnete sind keiner Partei oder der Nation verpflichtet, sondern ihren Wahlkreisen und Geldgebern. Das sorgt für Individualisierung und schwache Loyalitäten in den Kammern.
Zweitens ist die Verfassung der USA ausschließlich politisch orientiert. Sie enthält kaum Regelungen zu sozialstaatlichen Maßnahmen und auch keine Regulierung des Mediensystems. Im Unterschied zu Deutschland fällt es dem US-System daher weitaus schwerer, sozialstaatliche Maßnahmen zu ergreifen oder das Mediensystem in rationale Bahnen zu lenken. So ist zum Beispiel der alljährlich sich seit dem Zweiten Weltkrieg wiederholende Schlagabtausch über das Gesundheitssystem der USA mit inzwischen leeren Parolen nicht nur einfach auf Politiker zurückzuführen, die sich nicht einig werden können, sondern auch ein Missstand der Verfassung, weil für die Ordnung als Ganze die Gesundheitsvorsorge in die Regelungsmechanismen nicht eingeschrieben ist. Zugespitzt gesagt: Es steht nirgendwo geschrieben, dass sich der Staat um seine Bürgerinnen und Bürger zu kümmern hat. Nicht die passive Haltung der Trump-Regierung in der Corona-Krise ist das eigentlich Problematische, sondern die Verfassung des politisch-rechtlichen Apparates zeigt sich hier in ihren Grenzen. Die Annahme, dass es sich bei Gesundheit um etwas „Privates“ handelt, ist nicht nur Ausdruck tiefsitzender bürgerlich-kapitalistischer Prinzipien und Haltungen, sondern auch auf die fehlende Festschreibung jeglicher Sozialpolitik in der US-Verfassung zurückzuführen.
Das macht es schwierig, Sozialpolitik von vornherein als gemeinsames Ziel wahrzunehmen. Sich unversöhnlich gegenüberstehende Lager sind die logische Konsequenz des Verfassungsrahmens selbst. Wenn sozialstaatliche Ziele in einer Verfassung eingeschrieben sind, sorgen diese für eine Entpolitisierung, da sie für die Politisierung von Positionen und Lösungen ja schon vorausgesetzt sind. Bürger und Politiker können sich dann noch darüber streiten, wie soziale Ziele umgesetzt werden, aber nicht mehr, ob diese verfolgt werden sollen.
Die Aspekte, die die Krise der US-Verfassung ausmachen
Schauen wir uns einige andere Aspekte der US-Verfassung an, die in der gegenwärtigen Lage die Krise ausmachen.
Impeachment. Wie sehr sich Recht und Politik auseinanderdividiert haben, hat das (erste) Amtsenthebungsverfahren gegen Trump sehr gut gezeigt. Da es von vornhinein eine klare Sache war, dass sich die Republikaner bei den entscheidenden Abstimmungen auf die Seite des Präsidenten stellen würden, wurde das Anhörungsverfahren zur Farce. Was als fairer Prozess und als faire Auseinandersetzung gedacht ist, um die „checks and balances“ auch in der Realität durchzusetzen, wurde so zu einem leeren Prozedere, das von Anfang an keine Substanz hatte und am Ende auch kaum noch jemanden interessiert hat.
Das war noch ganz anders bei Nixon, als die gesamte Nation vor den Bildschirmen und Radios saß, weil sie es als etwas betrachtete, das alle Amerikaner angeht. In Trumps Fall aber zeigte sich, dass die Idee des Impeachments, da es keine unmittelbare Kontrolle der Exekutive durch das Parlament gibt, in leere Rhetorik umschlägt, sobald die legale Form des Verfahrens komplett auf politische Lagerbildung reduziert wird. So hat sich gezeigt, dass die Einflussnahme von Senat und Repräsentantenhaus auf die Exekutive nur schwach ist.
Um nur ein einfaches Beispiel zu nennen: die Benutzung des präsidialen Flugzeuges Air Force One zu Wahlkampfeinsätzen ist illegal, aber Trumps Benutzung des Flugzeuges hat am Ende keinen mehr gestört. Die offenkundige Übertretung von bis dahin anerkannten Regeln wird zur Normalität und wird nicht korrigiert, weil sie nicht korrigiert werden kann. Die Verfassung, die das Justizministerium durch den Generalstaatsanwalt zu nahe an die Exekutive anbindet, bleibt hier ein zahnloser Tiger.

Politik wird in den USA zur Propaganda und PR-Maschine
Geld und Werbung. Es ist schon so zur Normalität geworden, dass sich in den USA kaum mehr jemand aufregt, dass schon für Wahlen in den Einzelstaaten die Kandidatinnen und Kandidaten bis zu 20 Millionen Dollar aufbringen müssen, um überhaupt eine Chance zu haben, ins Rennen zu gehen. Das ist in den meisten Fällen nur möglich, wenn man entweder von mächtigen Lobbys unterstützt wird oder selbst reich ist. Während sich die Arbeitslosen im Zuge der Covid-19-Krise an der Tafel anstellen müssen, weil sie sonst nicht genug Essen auf dem Tisch haben, wurden um die 500 Millionen Dollar kürzlich in Georgia im Wahlkampf um die beiden verbliebenen Senatssitze verpulvert.
Die Sache ist profitträchtig für einen Teil des Kapitals: Ein großer Teil des Geldes geht zurück in die Medienindustrie, und die Firmen, die die Kampagnen durchführen und legal absichern, machen Profit. Politik wird hier reine Propaganda und PR-Maschine. Aber solange die Finanzierung des politischen Systems nicht verfassungsmäßig geregelt wird, wird sich an dieser Dynamik nichts ändern. Selbst politische Kriege sind immer auch Materialschlachten.
Irrationaler Traditionalismus im Partei-System
Parteien. Die Demokraten und Republikaner sind keine durchorganisierten Institutionen, die zum Mitmachen, zur Mitgliedschaft und zum Mitbestimmen einladen. Das Wort „Partei“ bestimmt in den USA nur, wer sich zu welcher Seite zugehörig fühlt. Die zumeist einzige Funktion, die Büros der Republikaner oder Demokraten in den Städten und Gemeinden haben, ist Geld für die nächste Wahl zusammenzubekommen. So etwas wie „Parteizentralen“ mit hierarchisch organisierten Entscheidungsstrukturen gibt es nicht. Damit sind Parteien nur auf die Wahl zugeschnitten, da sie nicht zur Organisationen des täglichen politischen Lebens beitragen. „Electoral politics“ heißt das in den USA. Damit fehlt eine vermittelnde Instanz zwischen den mit viel Geld in ihre Ämter Gewählten und den Bürgerinnen und Bürgern. Es gibt so gut wie keine Möglichkeit, Ärger oder Zustimmung durch institutionelle Partizipation in Handlungen zu übersetzen.
Die Abwesenheit der Parteien und einer von ihnen institutionalisierten öffentlichen Diskussion führt zu irrationalem Traditionalismus. Man ist in den USA Republikaner oder Demokrat, weil die eigene Familie es „schon immer“ war. Es gibt Schätzungen des Pew Research Centers, dass nur etwa sieben Prozent der Wahlbevölkerung wirkliche Wechselwähler sind. Parteizugehörigkeiten sind zu Identitäten verkommen und werden somit nicht mehr als politische Positionen definiert, die austariert und gegebenfalls verteidigt werden müssen. Polemik überwiegt. Ja oder nein. Schwarz oder weiß. Es gibt keine Ausgewogenheit. Entweder du bist für die Kandidaten und Kandidatinnen oder gegen sie.
Den Parteien in den USA fehlt es an einem Programm
Hass ist die Folge. Es ist kein Zufall, dass fast alle Wahlergebnisse der letzten Jahre mit hauchdünnen Mehrheiten entschieden werden. Denken wir an 2004 zurück. Obwohl die 9/11 Kommission wenige Wochen vor der Wahl des Präsidenten in einem detaillierten Report gezeigt hatte, dass die US-Regierung den Einmarsch im Irak auf einer Lüge aufgebaut hatte, wurde der damalige Präsident Bush im Amt bestätigt.
Dieser auf dem Zweiparteiensystem basierende irrationale Traditionalismus, die Identitätspolitik und die fehlenden Parteistrukturen führen auch dazu, dass Programme fehlen, die längerfristige Ziele der eigenen politischen Position bestimmen. Wenn man sich die Webseiten der demokratischen und republikanischen „Parteien“ anschaut, sieht man, dass es um Verwaltung und abstrakte Werte geht, aber nicht um politische Ziele oder politische Programme, in denen definiert wird, wo das Land in Zukunft stehen soll. Daher muss man zu dem Schluss kommen, dass ein Zweiparteiensystem – vor allen Dingen, wenn es nicht rein parlamentarisch ist wie in Großbritannien – die Tendenz zeigt, in der Innenpolitik dysfunktional zu werden.
Förderalismus und Wahlsystem schwächen die Bundesregierung der USA
Föderalismus und Wahlen. Dass es, wie oben angedeutet, keine richtigen Parteistrukturen gibt, liegt auch daran, dass die Verfassung der USA sehr stark, viel stärker als in Deutschland, auf einer föderalen Struktur aufbaut. Dies hat zwei Konsequenzen: Es führt dazu, dass die politischen Repräsentanten in Washington sich viel mehr ihren Wahlkreisen verbunden fühlen, als wirklich nationale Interessen in der Innenpolitik zu verfolgen. Zweitens ist es dadurch schwieriger, national operierende Ministerien aufzubauen, da diese dazu ja in die einzelstaatlichen Hoheiten eingreifen müssen. Daher gibt es vom Umweltschutz bis zur Verteilung des Covid-19-Impfstoffes Schwierigkeiten, dies zu organisieren. Wirklich gut funktioniert in den USA nur der Katastrophenschutz und das Militär.
Es ist daher kein Zufall, dass die nationale Regierung in Washington zumeist nur in Katastrophenfällen von den Staaten zur Hilfe gebeten wird. Die Wahlverfahren sind unorganisiert und basieren auf Regeln und Technologien, die nicht national einheitlich sind, selbst wenn es um die Wahl des Präsidenten geht.
Die Briefwahl hat dieses Jahr gezeigt, wie das System dysfunktional wird. Zum Beispiel konnte man in einigen Staaten erst kurz vor der Abstimmung die Briefwahl beantragen, obwohl klar war, dass die nationale Post mit riesigen Lieferverzögerungen zu kämpfen hatte. Die Wahlkarten sind nicht immer eindeutig, sodass viele Menschen sie an der falschen Stelle unterschreiben und ihre Stimmen ungültig werden. Aufgrund von schwerer Überlastung der nationalen Post wurde den Gerüchten, dass es bei den Wahlen nicht mit rechten Dingen zugeht, Vorschub geleistet. Die Wahlregistrierung bleibt aufgrund von unterschiedlichen Pass- und Identitätsdokumenten chaotisch und kann so von Trumpisten ausgenutzt werden.
Überproportionaler Einfluss der kleinen Bundesstaaten
Senatorenverteilung und Wahlmänner. Nicht nur das System der Wahlmänner und -frauen, über das sich ja inzwischen auch Nichtamerikaner wundern, sondern auch die Sitzverteilung in den beiden Kammern ist hochproblematisch. So ist es kaum jemandem verständlich zu machen, warum Kalifornien mit 40 Millionen Einwohnern genauso viele Senatssitze wie Montana mit einer Million Einwohnern bekommt. Das Magazin „Jacobin“ hat kürzlich mit einer einfachen Karte dargelegt, dass die Senatsmehrheit mit nur neun Prozent abgegebener Stimmen gesichert werden könnte. Natürlich versteht man, dass bei Einführung dieser Regel es um den Schutz der kleinen Einzelstaaten ging. In einem Superstaat im 21. Jahrhundert schlägt diese Form der disproportionalen Repräsentation der Bevölkerung aber genau in ihr Gegenteil um: Die kleinen Staaten, zumeist konservativ, haben überproportional Einfluss.
Reformen des politischen Systems der USA bleiben unwahrscheinlich
Begnadigungsrecht. Die Absurdität von quasifeudalen Einrichtungen wie die Begnadigungen von scheidenden US-Präsidenten hat sich in Trumps Fall als das erwiesen, was sie verfassungsmäßig sind, nämlich eine absolutistische Macht, das Recht auszuhebeln. In diesem Fall hat Trump die Sache nur zu ihrer inneren Konsequenz gebracht, um Verbündete und Familienmitglieder gegen Strafverfolgung abzusichern. Eine solche Haltung basiert auf Bandenmentalität, aber diese ist in die Verfassung eingeschrieben.
Dazu gehört auch, dass nicht nur die Ehegattinnen der Präsidenten ohne weitere Legitimierung in der Exekutive untergebracht werden oder Gegenkandidaten in der Vorwahl, wie Rudy Giuliani, die wichtigste Beraterposition in der Exekutive einnehmen, obwohl sie dafür nicht gewählt worden sind, sondern auch, dass die Tochter und der Schwiegersohn an wichtigen Stellen mitbestimmen – ohne sich jemals einem politischen Legitimationsprozess unterworfen zu haben. Das ist nicht einfach nur „Machtmissbrauch“, wie zuweilen von den Demokraten zu hören war, sondern es ist Teil der Ordnung selbst, weil es nicht von der Verfassung geregelt oder eingeschränkt wird.
Man muss zu dem Schluss kommen, dass, solange die Strukturen des US-amerikanischen politisch-rechtlichen Systems nicht zumindest reformiert werden und solange wir nicht verstehen, dass gesellschaftliche Probleme auch Effekte der Verfassung der Gesellschaft sind, so lange auch die benötigten Reformen in der Gesellschaft nicht möglich sein werden. Der verfassungsrechtliche Rahmen der USA aber befördert eine radikale Lagerbildung, und daher ist es sehr unwahrscheinlich, dass er substanzielle Reformen generiert. (Christian Lotz)
Christian Lotz
Jahrgang 1970, ist Professor für Philosophie an der Michigan State University (East Lansing) und lebt seit 20 Jahren in den USA.